Es ist Zeit zu handeln
Wir engagieren uns für die Artenvielfalt in Deutschland – mit unserer Unterstützung wird die Population vom Aussterben bedrohter Tierarten hierzulande dauerhaft geschützt.
Deutschlands Artenvielfalt zeigt sich in einem alarmierenden Zustand, deswegen ist uns bei Krombacher Artenschutz ein besonderes Anliegen – es war Zeit zu handeln! Dabei haben wir uns u. a. auf bedrohte Tierarten wie den Luchs, den Fischotter, den Schreiadler, die Eisente und die Kegelrobbe konzentriert, wobei die gesamte Flora und Fauna von unseren Maßnahmen profitiert.
Die von uns geschützten Arten haben allesamt besonders hohe Ansprüche an ihre Lebensräume. Deswegen suchten wir gemeinsam mit unseren Partnern nach Gebieten, die möglichst frei von anderen Nutzungsinteressen sind und so die besten Voraussetzungen für den erfolgreichen Artenschutz dieser Tiere bieten.

Natur regenerieren
Deutschlands wilde Natur wurde über die Jahrhunderte hinweg stark zurückgedrängt. Bereits im frühen Mittelalter verschwanden die letzten geschlossenen Urwälder. Der Mensch verdrängte Bären, Wölfe und Luchse in abgelegene Regionen. Mithilfe konsequenter Renaturierungsmaßnahmen müssen daher neue Lebensräume erschlossen werden, damit bedrohte Tierarten in Deutschland wieder heimisch werden können.

Flüsse zu Lebensadern machen
Die Flüsse in Deutschland sollen in Zukunft wieder ihrer Funktion als Lebensader für bedrohte Tierarten in Deutschland gerecht werden. Es müssen Wanderkorridore mit weitläufigen, sich verändernden Auenlandschaften geschaffen werden, die eine riesige Artenfülle beherbergen können.

Naturnahe Wälder schaffen
Deutschland galt einst als das Land der Buchenwälder, doch heute bestehen deutsche Wälder zu mehr als der Hälfte aus naturfernen Nadelbaumforsten. Die Renaturierung der Wälder muss entschlossen vorangetrieben werden, damit sich bedrohe Tierarten in Deutschland wieder ansiedeln können.

Landwirtschaft sensibilisieren
Durch die fortschreitende Intensivierung der Landwirtschaft sind viele Arten, Lebensgemeinschaften und Lebensräume gefährdet. Die Landwirtschaft muss daher für bedrohte Tierarten in Deutschland sensibilisiert werden, um den Artenreichtum hierzulande wiederaufzubauen.
Über 2,3 Mio. Euro für den Artenschutz
Zusammen mit renommierten Naturschutzorganisationen riefen wir 2016 das große Krombacher Artenschutz-Projekt ins Leben. Gemeinsam machen wir uns für den heimischen Artenschutz stark. "Schützen und Genießen" lautet dabei der Leitgedanke unserer Offensive für bedrohte heimische Arten. Über 2,3 Mio. Euro konnten wir bereits in den Artenschutz unserer heimischen Tiere investieren.
2016:
1.862.165 €
2016 konnten wir durch die Hilfe der Verbraucher und mit jedem verkauften Kasten Krombacher wichtigen Lebensraum für Deutschlands bedrohte Tiere schützen. Dabei kam eine beachtliche Summe zusammen, die unsere Erwartungen bei weitem überstieg: 1.862.165 Euro!
2017:
514.750 €
Auch 2017 setzten wir unser Engagement für Deutschlands bedrohte Tiere fort. Gemeinsam mit unseren Partnern weiteten wir unsere Artenschutz-Projekte konsequent aus. Diesmal konnten wir insgesamt 514.750 Euro zur Verfügung stellen.
Gezielte Tier-Förderung
Mit den bereitgestellten Förderbeträgen konnten wir Projekte unterstützen und Maßnahmen finanzieren, die sich für den Schutz des Luchses, des Fischotters, des Schreiadlers, der Eisente, der Kegelrobbe und vielen weiteren Arten einsetzen.

Starke Allianz für den Luchs
Der Luchs war früher in ganz Mitteleuropa verbreitet. Nach fast 250 Jahren Abwesenheit streift er heute wieder durch den Pfälzerwald in Deutschland.
Eine wichtige Herausforderung ist es, dem Luchs ausreichend zusammenhängende, naturnahe Waldflächen zur Verfügung zu stellen, die nicht durch Straßen zerschnitten werden, da dies insbesondere für Jungtiere gefährlich ist.
Da eine natürliche Zuwanderung in den Pfälzerwald unwahrscheinlich war, wurde Luchsen nach 250 Jahren ein neuer Lebensraum durch Auswilderung geschaffen. Ziel ist es, den Luchs in Deutschland wieder heimisch zu machen und seinen Lebensraum langfristig zu sichern.
Seit 2016 wurden neun Luchse ausgewildert, bis 2021 sollen es insgesamt 21 sein. Zwei Weibchen haben bereits Nachwuchs bekommen, was die Eignung des Biosphärenreservats Pfälzerwald als Lebensraum bestätigt.
Gutachten zeigen, dass bis zu 100 Luchse im Pfälzerwald und den angrenzenden Vogesen leben könnten. Verschiedene Naturschutzorganisationen arbeiten zusammen, um die Rückkehr des Luchses nach Mitteleuropa langfristig zu sichern.
Im Pfälzerwald finanzierten wir ein neues großzügiges Auffanggehege, in welchem Luchse medizinisch versorgt werden. Wir achteten bei der Auswahl des Gebiets darauf, dass es frei von anderen Nutzungsinteressen ist. Auf diese Weise können wir die Tiere hier bestmöglich schützen und fördern.

Dauerhaft angelegtes Projekt
Angelika Richter, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin des Naturschutzbund (NABU), lobt die Erfolge der bisherigen Kooperation mit Krombacher im Artenschutz: "Mit der Wiederansiedlung des Luchses im Pfälzerwald konnten wir in den vergangen Jahren ein überaus wichtiges Artenschutz-Projekt realisieren."

Mehr Lebensraum für den Fischotter
Der Fischotter ist eines der am stärksten gefährdeten Säugetiere Europas. Seine Wiederausbreitung erfordert Renaturierung von Gewässern und sichere Gestaltung von Brücken.
Der Schutz des Fischotters wird durch die Trockenlegung von Feuchtgebieten, die Entfernung von Ufervegetation, Gewässerbegradigungen sowie den Bau von Dämmen und Straßen erschwert, die oft nicht die Bedürfnisse des Fischotters berücksichtigen.
In den Feuchtgebieten der Feldberger Seen und Mühlenbäche im südlichen Mecklenburg-Vorpommern soll ein weiteres Absinken der Wasserstände durch wasserrückhaltende Maßnahmen verhindert werden, um den Lebensraum des Fischotters dauerhaft zu sichern.
Der WWF hat Flächen im Godendorfer Mühlenbachtal erworben, um dort den Wasserstand wieder anzuheben. Bisher wurden 40 Seitengräben verschlossen, wodurch der Wasserstand 2016 um 30–50 cm erhöht werden konnte. Weitere Maßnahmen wie Dammbauten im benachbarten Dabelower Mühlenbachtal sind in Planung.

Erfolg
Im südlichen Mecklenburg-Vorpommern ist der Fischotter heute wieder zuhause. Das Wassereinzugsgebiet bietet außerdem Fischen, Amphibien, Libellen, Bibern und anderen Arten einen Lebensraum. Der WWF möchte das weitere Absinken der Wasserstände stoppen.

Sichere Gehwege für den Fischotter
Der Fischotter zählt zu den am stärksten durch den Straßenverkehr gefährdeten Säugetieren im gesamten europäischen Raum. Deshalb engagieren wir uns aktiv im Fischotterschutz.
Der Fischotter bewegt sich regelmäßig zwischen Wasser und trockenem Ufer. An manchen Flüssen fehlen jedoch ausreichend trockene Uferbereiche, wodurch die Tiere Straßen überqueren, insbesondere an Brücken. Dies führt häufig zu tödlichen Unfällen, da das Überfahrenwerden die häufigste Todesursache für Fischotter darstellt. Der Schutz der Tiere wird dadurch erheblich erschwert.
In Thüringen wurde ein erfolgreiches Umbauprogramm für Fischottergewässer umgesetzt, das als Vorbild für bundesweite Maßnahmen dient. Ziel ist es, die Zahl der überfahrenen Otter zu reduzieren, indem individuelle Passierhilfen geschaffen werden, die es den Tieren ermöglichen, Brücken sicher und trocken zu unterqueren.
Fischotter sind aktive Tiere mit großen Revieren und legen oft Strecken von über 20 km pro Nacht zurück. Dabei stellen Straßen tödliche Hindernisse dar. Effektiver Schutz erfordert die Entschärfung dieser Gefahren und die bessere Vernetzung von Flusslandschaften. Bereits konnten durch die DUH drei fischottergerechte Brücken realisiert werden, die das Überleben der Tiere sichern.
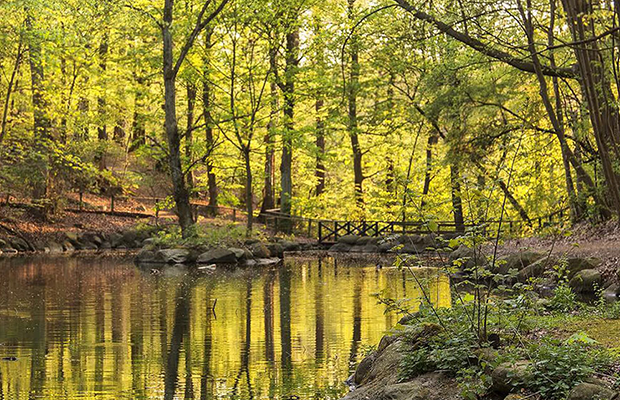
Erfolg
Für das Krombacher Artenschutz-Projekt etablierte unser Partner gemeinsam mit Wasser-, Umwelt- und Straßenverkehrsbehörden aus 13 Bundesländern neue Standards für den Bau und Umbau fischottergerechter Brücken.
Kartierungen beweisen, dass die umgebaute Brücke in Gera (Ost-Thüringen) tatsächlich von Fischottern genutzt wird. Die Brücke wurde im Winter 2016 fischottergerecht neugestaltet.

Nestschutz für den Schreiadler
In Deutschland gibt es nur noch etwa 110 Schreiadler-Paare. Als eine der am stärksten bedrohten Vogelarten wurde sie in den Nordosten verdrängt. Krombacher unterstützt daher den Nestschutz.
Der Schutz des Schreiadlers ist herausfordernd, da sein Lebensraum durch Grünlandverlust, Holzeinschlag, Entwässerung und Straßenbau bedroht wird. Diese Eingriffe reduzieren die Nahrungsverfügbarkeit und stören die Brutplätze.
Die Deutsche Umwelthilfe und der Naturschutzbund setzen sich in der Ueckermünder Heide und Umgebung dafür ein, den Lebensraum des Schreiadlers zu erhalten und zu verbessern. Ziel des Projekts ist es, die langfristige Population des Adlers zu sichern.
Um die Jagdmöglichkeiten des Schreiadlers zu fördern, wurde die Grünlandbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit Landnutzern angepasst. Wiedervernässungen von kleinen Gewässern und Waldmooren erhöhen die Amphibienpopulationen, die eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Kletterschutzmanschetten an den Horstbäumen verhindern, dass Jungvögel durch Baummarder oder Waschbären gefährdet werden.

Erfolgreiche Brut & Aufzucht
Wir freuen uns sehr darüber, dass 2017 ein Schreiadler-Brutpaar in der Nordwestuckermark erfolgreich brütete und einen Jungvogel aufzog. Das junge Tier verbrachte 58 Tage in seinem Nest in einem ungestörten, abgelegen Teil des Waldes – gut gewärmt von seinen Elternvögeln und mit Mäusen, Schnecken, Fröschen und Eidechsen als Nahrung versorgt.

Nahrungsflächen für den Schreiadler
Nur noch knapp 110 Paare des Schreiadlers brüten in Deutschland. Um ihren Erhalt hierzulande zu sichern, benötigen Sie nahrungsreiche Brutflächen.
Der Schreiadler ist auf unberührte, waldreiche und feuchte Landschaften angewiesen, die lange Grenzlinien zwischen Wald und Wiese aufweisen. Er kehrt jedes Jahr zum selben Ort zurück, oft über Jahrzehnte hinweg. Die Herausforderung besteht darin, ihm diese speziellen Lebensräume dauerhaft bereitzustellen, um sein Überleben zu sichern.
Der WWF setzt sich dafür ein, wichtige Brutflächen zu sichern, die dem Schreiadler genügend Nahrung bieten. Ziel des Projekts ist es, die Art langfristig in der Uckermark zu erhalten.
Der Schreiadler benötigt einen abwechslungsreichen und störungsarmen Lebensraum aus feuchtem Wald mit angrenzendem Grünland. Durch die langfristige Pflege solcher Flächen in der Uckermark hat der WWF neue, artgerechte Lebensräume geschaffen, die dem Schreiadler eine ausreichende Nahrungsgrundlage bieten.

Erfolgreiche Maßnahmen
Mithilfe des Krombacher Artenschutz-Projekts wurden bereits 35 Hektar Wiesen in direkter Nachbarschaft zum Naturwald in der Nordwestuckermark langfristig gesichert.
Die DUH und der NABU setzen zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraums des Schreiadlers um. Gemeinsam mit den Landnutzern optimieren sie so die Grünlandbewirtschaftung. Außerdem werden kleine Gewässer und Waldmoore wieder vernässt, sodass ihre Attraktivität für Amphibienarten zunimmt, die dem Schreiadler als Nahrung dienen. Kletterschutzmanschetten an den Horstbäumen der Vögel verhindern, dass ihr Nachwuchs Opfer von Baummardern oder Waschbären wird.

Mehr Gewässer für den Schwarzstorch
Nahrungsreiche Gewässer sind genauso wichtig für den Lebensraum des Schwarzstorchs wie reichhaltige Altholzbestände und Ruhe für seine Brut.
Der Schwarzstorch benötigt ruhige Wälder mit Tümpeln und kleinen Bächen für die Nahrungssuche und Brut. Die Herausforderung besteht darin, solche nahrungsreichen Gebiete mit Wasserinsekten, Larven und Köcherfliegen zugänglich zu machen.
Der Naturschutzbund möchte in der Lapitz-Geveziner Waldlandschaft durch Renaturierung die Lebensräume des Schwarzstorchs in der Mecklenburgischen Seenplatte sichern. Dazu sollen intensiv bewirtschaftete Äcker in artenreiches Dauergrünland umgewandelt und durch ein angepasstes Nutzungsmanagement in beutereiche Jagdgebiete verwandelt werden.
Bereits gesicherte Wiesen wurden durch Grabenverschlüsse und Verplombung von Rohrdurchlässen weiter vernässt. Die Anhebung des Wasserspiegels schafft zusätzliche kleine Nahrungsgewässer. Eine Wasserbüffelherde wurde angesiedelt, um die Wiesen zu pflegen und nachhaltig zu bewirtschaften.

Mehr Ruhe für die Kegelrobbe
Lange war sie an deutschen Küsten verschwunden, jetzt kehrt die Kegelrobbe zurück. An manchen Stränden kann das größte Raubtier Deutschlands heute wieder beobachtet werden.
Früher wurden Kegelrobben durch Bejagung und Umweltgifte stark gefährdet. Obwohl sich der Bestand seit den 1980er-Jahren erholt, bedrohen heute Verhaken in Fischernetzen und Störungen durch Wassersport ihre Rastplätze. Die Stabilisierung der Population bleibt daher wichtig.
Im südlichen Ostseeraum sollen mehr störungsfreie Ruheplätze entstehen, damit Kegelrobben ungestört liegen und ihre Jungen aufziehen können. Die DUH arbeitet mit Fischern und Institutionen an einem nachhaltigen Fischerei-Management, um Beifang zu reduzieren und geschützte Bereiche zu sichern.
Die Deutsche Umwelthilfe schuf Beruhigungszonen und renaturierte Uferbereiche, um Kegelrobben und anderen Arten wie der Eisente im Stettiner Haff mehr Rückzugsorte zu bieten.
Langfristiges Engagement
Wir bei Krombacher engagieren uns bereits seit Jahrzehnten im Umwelt- und Naturschutz. Von unserem Regenwald-Projekt in Zentralafrika über unser Klimaschutz-Projekt bis hin zu unserem Artenschutz-Projekt in Deutschland.

"Krombacher steht zu seiner Verantwortung gegenüber Mensch und Natur. Wir möchten unser Artenschutz-Projekt langfristig weiterentwickeln – kurz gesagt: wir machen weiter!"
Wolfgang Schötz, Leiter Vertriebsmarketing der Krombacher Brauerei









